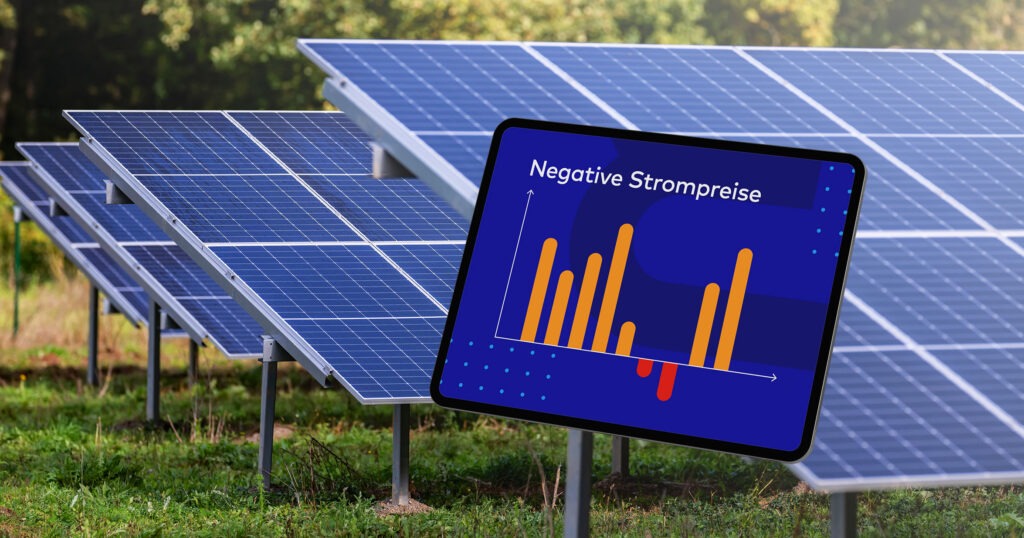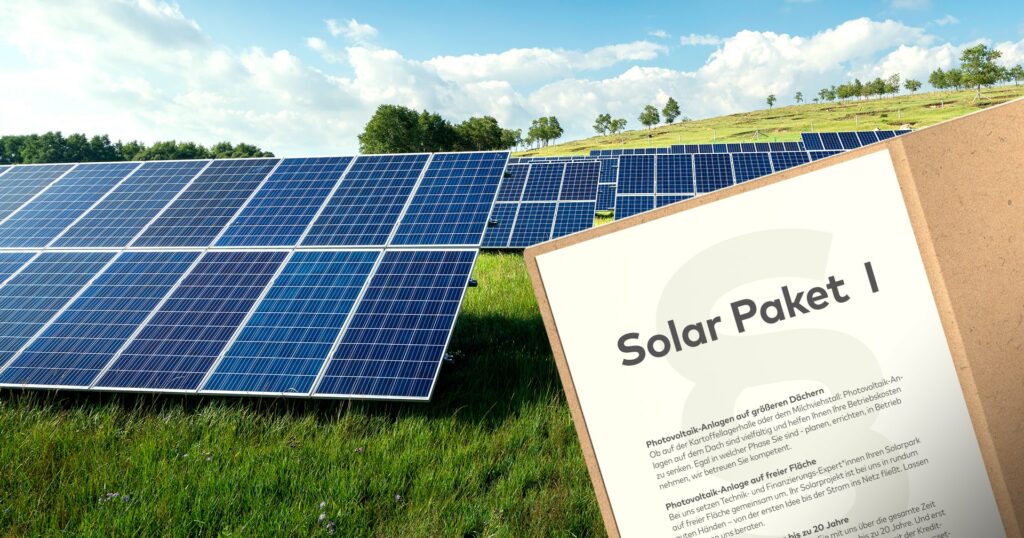Erneuerbare Energien
Aktuelle Blogbeiträge & News zur Energiebranche
Mai 27, 2025
Mai 19, 2025
Januar 30, 2025
Juli 5, 2024
März 15, 2024
Oktober 16, 2023
Juli 21, 2023
Oktober 27, 2022
Jetzt zum Newsletter anmelden
Neuigkeiten rund um Direktvermarktung, Batterievermarktung und Energiewende Trends