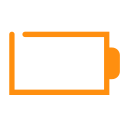Zur Erlösmodellierung von Batteriespeichern wird häufig Backtesting eingesetzt. Doch der vermeintlich objektive Blick in die Vergangenheit täuscht: Die Ergebnisse beruhen auf idealisierten Annahmen, die in der Realität nicht standhalten. Mit unserem Batteriespeicher-Index bieten wir eine Alternative: Eine Erlösformel, die auf klar definierten und nachvollziehbaren Parametern beruht. Sie zeigt transparent, was ein Batteriespeicher tatsächlich verdient hätte – und schafft damit eine verlässliche Grundlage für fundierte Entscheidungen. Warum das Backtesting nicht ausreicht und welche Faktoren der Index beinhaltet, beleuchten wir in diesem Blogbeitrag.
Wo liegen die Grenzen von Backtests?
Backtesting liefert oft beeindruckende, auf den ersten Blick vielversprechende Zahlen. Doch wie zuverlässig sind diese Werte tatsächlich? Backtesting bedeutet letztlich eine Simulation, wie viel ein Batteriespeicher in der Vergangenheit – im letzten Jahr oder in den letzten fünf Jahren – an den Strommärkten hätte tatsächlich verdienen können. Rückblickend kennt man den besten Trade und kann damit auch den Best Case für die Erlöse berechnen. Gerade beim Vergleich von Backtestergebnissen für Stand-alone-Speicher verschiedener Vermarkter führt dies zu Problemen: Einerseits basieren die Modellrechnungen häufig auf idealisierten Annahmen. Anderseits werden diese historischen Best-Case-Zahlen von den Vermarktern genutzt, um Prognosen für die Zukunft abzuleiten. Wie sinnvoll ist also ein solcher Vergleich, wenn die zugrunde liegenden Parameter uneinheitlich, teils willkürlich gewählt sind und letztlich nur bedingt Aufschluss über die Erlöse in der Zukunft geben?
Häufig unrealistische Parameter
Beim Backtesting wird unter idealen Bedingungen gerechnet (perfect foresight). Das liefert zwar theoretisch optimale Ergebnisse, entspricht aber nicht der Praxis. So kann etwa die unrealistische Festlegung von Parametern zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen. Eine solche Annahme könnte beispielsweise auch darin bestehen, dass der Batteriespeicher über das gesamte Jahr hinweg zu 100 % verfügbar ist – ohne Wartungsarbeiten oder Ausfälle. Ebenso werden beispielsweise notwendige Testbetriebs- und Präqualifikationszeiträume vor der Vermarktung nicht einbezogen. Stattdessen wird angenommen, dass der Speicher ab dem ersten Tag in allen Märkten aktiv sei. Solche Szenarien sind in der Praxis unrealistisch und können zu überhöhten Erwartungen an die möglichen Erlöse führen.
Ignorieren von Marktbesonderheiten
Um den Idealerlös zu erzielen, modellieren Vermarkter beim Backtesting Speicher häufig so, dass marktspezifische Eigenschaften, wie zum Beispiel die jeweiligen Marktgrenzen bei Primär- (PRL) und Sekundärregelenergiemärkten (SRL) nicht beachtet werden. So kann es unrealistisch sein, ein großes Speicherprojekt in einen Markt mit stark begrenzter Kapazität zu planen. Der so simulierte Erlös basiert somit auf idealen Werten, welche in der Realität nicht umgesetzt werden können.
Eng damit verbunden ist die Annahme, dass eigene Handelsaktivitäten den Markt nicht beeinflussen. In der Praxis bewegt jedoch jede Handelsaktion den Marktpreis. Wenn ein Batteriespeicher durch seine Aktivitäten bestimmte Erlöspotenziale realisiert, verändert das die zukünftigen Marktpotenziale. Insbesondere bei Speicherprojekten mit großem Volumen ist der preisbeeinflussende Effekt der eigenen Handelsaktivität relevant, wird jedoch in Backtests meist nicht berücksichtigt.
Nichtberücksichtigung der Marktliquidität
Generelle Marktbedingungen, wie Marktliquidität, werden von den Vermarktern nicht immer realistisch einbezogen. Beim Backtesting wird angenommen, dass der Handel stets zum gewünschten Preis erfolgt. In der Realität können jedoch geringe Liquidität und große Aufträge den Handel beeinflussen, sodass Gewinne sinken – etwa wenn große Batterien nicht die gesamte Energiemenge zu den besten Preisen handeln können. Da Backtests häufig mit kleinen Speichern durchgeführt werden, bedeutet dies bei Übertragung auf große Speicher überoptimistische Ergebnisse, die in der Realität nicht umsetzbar sind.
Aufgrund der genannten Annahmen ist es nicht zielführend, Backtestzahlen verschiedener Vermarkter zu vergleichen, um die Auswahlentscheidung zu treffen. Schließlich spiegeln die unter idealen Bedingungen errechneten Erlöse aus den Backtestzahlen nicht die tatsächlich auszuzahlenden Beträge wider.
Unsicherheiten für zukünftige Erlöse
Backtesting im Stromhandel dient dazu, anhand historischer Preise zu ermitteln, welche Erlöse eine Handelsstrategie in der Vergangenheit erzielt hätte. Wenn auf dieser Basis Projektionen für die Zukunft vorgenommen werden, setzt das voraus, dass sich zukünftige Marktsituationen ähnlich, beziehungsweise identisch, wie vergangene verhalten. Zugleich impliziert dies, dass Preise von morgen bereits bekannt wären, um den optimalen Fahrplan zu berechnen. Die Erlösmodellierung durch Backtesting ist folglich nicht nur rückwärtsgerichtet eingeschränkt verlässlich – da Vermarkter dabei mit vereinfachten und teils unrealistischen Parametern rechnen –, sondern auch zukunftsbezogen keine verlässliche Entscheidungsbasis.
Hinzu kommt die Gefahr der Überoptimierung, d.h. wenn die Optimierung zu stark an historischen Preisen ausgerichtet wird (overfitting). So werden zwar im Backtest gute Ergebnisse der Handelsstrategie erreicht, jedoch wird bei neuen Marktsituationen nicht das Optimum erzielt. Besonders im Energiesektor ist dies der Fall, der durch Marktveränderungen, unvorhersehbare wirtschaftliche oder politische Entwicklungen sowie ständig neue rechtliche Regelungen geprägt ist. Diese führen zu sich ständig ändernden Marktbedingungen.
Unsere Lösung: Batteriespeicher-Index zur Erlösmodellierung – was steckt dahinter?
Wir setzen in der Erlösmodellierung auf eine transparente Alternative: eine Erlösformel, der Speicherindex, statt Backtesting mit unrealistischen Auszahlungsbeträgen unter simulierten idealen Bedingungen. Der BESS–Index basiert auf realisierten nachvollziehbaren Marktpreisen und liefert eine exakte Berechnung der Erlöse typischer Speicher.
Transparente Berechnung des Speicherindexes
Der Index zeigt, was eine typische Batterie in Deutschland – je nach Konfiguration (1h-, 2h- oder 3h-Systeme mit 1,5 oder 2 Vollladezyklen (VLZ) täglich) – tatsächlich verdient hätte. Er ist somit maximal transparent und jederzeit mit einfachen Mitteln nachvollziehbar. Dadurch ist er auch für Banken ideal, da er eine belastbare Rechengrundlage bietet.
Faire Behandlung aller Speicher
Wir behandeln alle Speicher in unserem Portfolio gleich, unabhängig von den jeweiligen Konditionen wie zum Beispiel Profit Shares oder vereinbarte Floor-Zahlungen. Je größer das Portfolio eines Vermarkters ist, desto wichtiger wird die Einsatzreihenfolge der Speicher. Insbesondere in den vergleichsweise kleinen PRL- und SRL-Märkten ist dann zu entscheiden, welcher Speicher die besseren Preise erhält. So könnte ein Vermarkter einen Speicher, bei dem der Kunde bessere Vertragskonditionen ausgehandelt hat, benachteiligen und einen Speicher mit schlechteren Konditionen für den Kunden, aber höherem Profit-Share für sich selbst, priorisieren, um eigene Gewinne zu maximieren.
Der Index sorgt dafür, dass die Einsatzreihenfolge der Batteriespeicher unabhängig von individuellen Verträgen ist und macht auch keinen Unterschied zwischen EnBW-eigenen Speichern und Anlagen Dritter. Auf diese Weise verhindert der Index, dass Vermarkter ihre eigenen Interessen über faire Marktchancen stellen, da alle Speicher gleich behandelt werden.
Bestpreisgarantie – BESS-Index bietet Sicherheit für optimale Erlöse
Innerhalb der vorgegebenen Speicherspezifikationen, wie VLZ oder Kapazität, werden für Kunden immer die besten Preispaare auf den Intraday- und Day-Ahead-Märkten gebildet. Ob diese Trades tatsächlich umgesetzt werden, liegt nicht im Risiko der Kunden. So ist sichergestellt, dass Kunden täglich die bestmöglichen Spreads für ihre Speicher erhalten.
Partizipation an Märkten ohne physische Teilnahme
Bereits ab dem ersten Tag profitieren Kunden von allen Märkten, selbst wenn ihr Speicher später erst präqualifiziert wird. Der Index garantiert, dass wir jeden Tag Umsätze aus allen potenziell verfügbaren Märkten an die Anlagenbetreiber auszahlen – unabhängig ob der Batteriespeicher dort tatsächlich eingesetzt wurde. Das heißt, die Auszahlung der Regelenergiemarkt-Umsätze ist ohne tatsächliche Teilnahme möglich.
Fazit: BESS-Index statt Backtesting – der bessere Weg?
Eine Erlösabschätzung auf Basis der Simulation eines Algorithmus mittels historischer Preise (Backtesting) kann nur eingeschränkt als Grundlage für tatsächliche Erlöse in der Vergangenheit genutzt werden. Dagegen bietet der Batteriespeicher-Index eine robuste, transparente und faire Entscheidungsgrundlage, da die errechneten Erlöse vertraglich zugesichert gewesen wären. Der Index basiert auf klar definierten, nachvollziehbaren Parametern und zeigt, was eine typische Batterie tatsächlich verdient hätte. Dabei behandelt er alle Speicher gleich und ist von Eigeninteressen unabhängig. Damit bietet der Index eine verlässliche Beschreibung für historische Erlöse.
Wie hilfreich war dieser Artikel?
Zum Bewerten auf die Sterne klicken
Durchschnittliche Bewertung 4.7 / 5. Anzahl Bewertungen: 18
Noch keine Bewertung, sei der Erste!